Suche
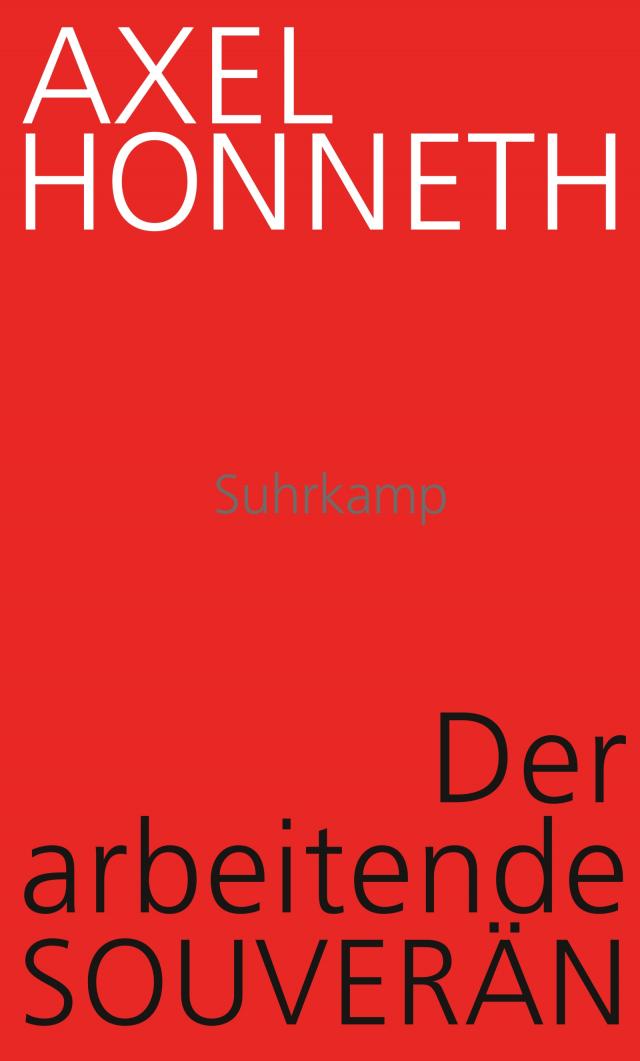
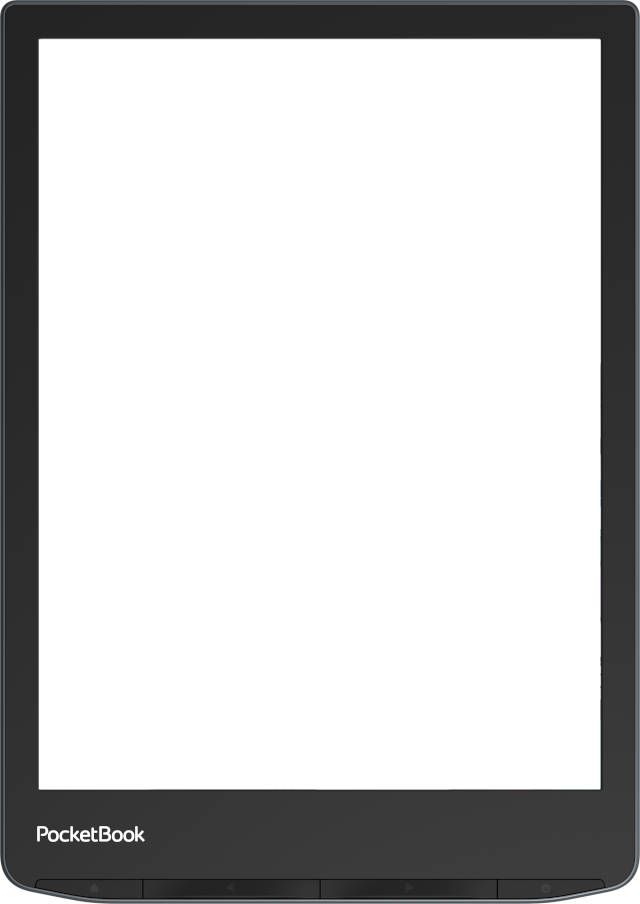
Der arbeitende Souverän
Eine normative Theorie der Arbeit | Axel Honneth
E-Book
2023 Suhrkamp Verlag
Auflage: 1. Auflage
400 Seiten
ISBN: 978-3-518-77572-1
in den Warenkorb
- EPUB sofort downloaden
Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Hardcover erhältlich
»Es gehört zu den größten Mängeln fast aller Theorien der Demokratie, mit erstaunlicher Hartnäckigkeit immer wieder zu vergessen, dass die meisten Mitglieder des von ihnen lauthals beschworenen Souveräns stets auch arbeitende Subjekte sind.«
Welche Rolle spielt die Organisation von Arbeitsverhältnissen für die Bestandssicherung eines demokratischen Gemeinwesens? Das ist die Frage, der Axel Honneth in seiner neuen großen Monographie nachgeht, deren Schlüsselbegriffe »gesellschaftliche Arbeit« und »soziale Arbeitsteilung« sind. Seine zentrale These lautet, dass die Teilnahme an der demokratischen Willensbildung an die Voraussetzung einer transparent und fair geregelten Arbeitsteilung gebunden ist.
Honneth begründet zunächst, warum es gerechtfertigt ist, die Arbeitsverhältnisse auf ihre Demokratieverträglichkeit hin zu prüfen. Dann zeichnet er die Entwicklung der Arbeitsbedingungen seit dem Beginn des Kapitalismus im 19. Jahrhundert nach. Fluchtpunkt dieses mit eindrücklichen literarischen Zeugnissen illustrierten historischen Streifzugs, der unter anderem in die Welt der Landarbeiter, der - zumeist weiblichen - Dienstboten und der ersten Industriearbeiter führt, ist die Vermutung, dass die heutigen Arbeitsverhältnisse zunehmend die Chancen zur aktiven Teilnahme an der demokratischen Meinungs- und Willensbildung untergraben. Daher wird im letzten Teil des Buches umrissen, an welchen Scharnierstellen eine Politik der Arbeit heute anzusetzen hätte, um den sich abzeichnenden Missständen entgegenzuwirken und zu einer dringend benötigten Neubelebung demokratischer Partizipation beizutragen.
Axel Honneth, geboren 1949, ist Jack C. Weinstein Professor of the Humanities an der Columbia University in New York. 2015 wurde er mit dem Ernst-Bloch-Preis, 2016 für Die Idee des Sozialismus mit dem Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch ausgezeichnet. 2021 hielt er in Berlin seine vielbeachteten Benjamin-Lectures zum Thema des Buches Der arbeitende Souverän.
Beschreibung für Leser
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
Eine verschüttete Tradition
Zu weiten Teilen bildet die industrielle Ordnung [...] den Schlüssel zur Paradoxie der politischen Demokratie. Warum sind die Vielen nominell der oberste Souverän, faktisch aber machtlos? Weitgehend weil ihre Lebensumstände sie nicht an die Ausübung von Macht oder Verantwortung gewöhnen oder heranführen. Eine industrielle Knechtschaft spiegelt sich zwangsläufig in politischer Knechtschaft wider.
- G.__D.__H. Cole[53]
Schon bei Adam Smith blitzt in seiner Untersuchung über den Reichtum der Nationen, wie bereits erwähnt, an einer Stelle der Gedanke auf, dass zwischen der Art und Beschaffenheit der Arbeit, die jemand verrichtet, und seiner Fähigkeit zur Teilnahme an der politischen Kommunikation eine ganz enge Verbindung besteht. Im fünften Abschnitt von Buch V seiner umfangreichen Schrift, in dem er aufzählt, welche Pflichten der politischen Führung eines Gemeinwesens obliegen, heißt es, dass die »zunehmende Arbeitsteilung« die erwerbsmäßige Tätigkeit eines großen Teils der Bevölkerung auf erschreckend wenige, sehr einfache Verrichtungen zusammenschrumpfen lässt; die »geistige Abstumpfung« und seelische Verkümmerung, die das bewirke, so fährt Smith 63fort, sei aber der Entwicklung einer »zivilisierten Gesellschaft« im hohen Maße abträglich, weil diese doch darauf angewiesen sei, dass alle ihre Mitglieder »geistige« und »gesellschaftliche« Fähigkeiten erwerben können.[54] Die Ausbildung solcher Befähigungen sind Smith zufolge deshalb notwendig für ein zivilisiertes Sozialleben, weil ein jedes erwachsene Gesellschaftsmitglied in der Lage sein müsse, sich »über die großen und weitreichenden Interessen seines Landes« ein Urteil bilden zu können.[55] Dies ist keine selbstverständliche Auskunft in einer Epoche, die noch weit davon entfernt ist, den erwerbstätigen Massen ein Recht auf politische Meinungsbildung oder gar demokratische Mitbestimmung einzuräumen. Warum sollte also das Volk, wenn es doch keinerlei Anspruch auf demokratische Kontrolle der Regierungstätigkeit besitzt, gleichwohl davor bewahrt werden, sich aufgrund der Eintönigkeit, des Stumpfsinns und der Anstrengung der zu verrichtenden Arbeit kein Urteil über die allgemeinen Belange des Landes bilden zu können? Wiederum überrascht die Klarheit der Antwort, die Smith auf diese Nachfrage erteilt: Weil ansonsten die Machthabenden nicht auf die Nachvollziehbarkeit und Bewilligung der von ihnen erlassenen Gesetze von Seiten des Volkes hoffen könnten. Deutlicher lässt sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts, also einige Jahrzehnte vor der Französischen Revolution, kaum artikulieren, dass eine Regierung auf die Arbeits- 64und Beschäftigungsbedingungen im eigenen Hoheitsgebiet deswegen zu achten habe, weil von deren Beschaffenheit nicht zuletzt abhängt, ob die erwerbstätige Bevölkerung die politischen Erlasse vollständig verstehen, sie begründet gutheißen und schließlich auch dem Sinn nach beherzigen kann; und je weniger belastend, je weniger eintönig und abstumpfend die individuelle Arbeitstätigkeit jeweils sei, so scheint Smith sagen zu wollen, desto größer auch die Chance seitens der Einzelnen, sich von den politisch dringlichen Aufgaben ihres Landes ein angemessenes Bild zu machen und damit wenigstens im Grundsatz die Regierungsmaßnahmen auf ihren Wert hin beurteilen zu können.[56] Anstatt aber nun politische Eingriffe in den Arbeitsmarkt selbst ins Auge zu fassen, mittels deren die individuellen, arbeitsteilig verzahnten Beschäftigungen dem Ziel einer größeren Komplexität und einer geringeren Belastung direkt angepasst werden könnten, schlägt Smith nur indirekte Maßnahmen der außerbetrieblichen Bildung vor, um den von ihm diagnostizierten Gefähr
