Suche
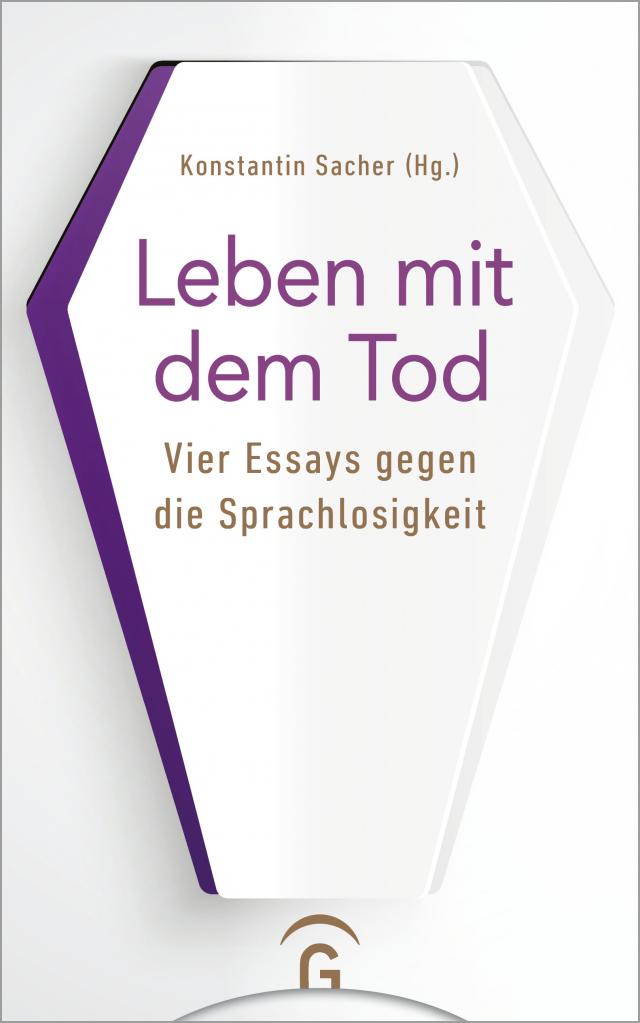
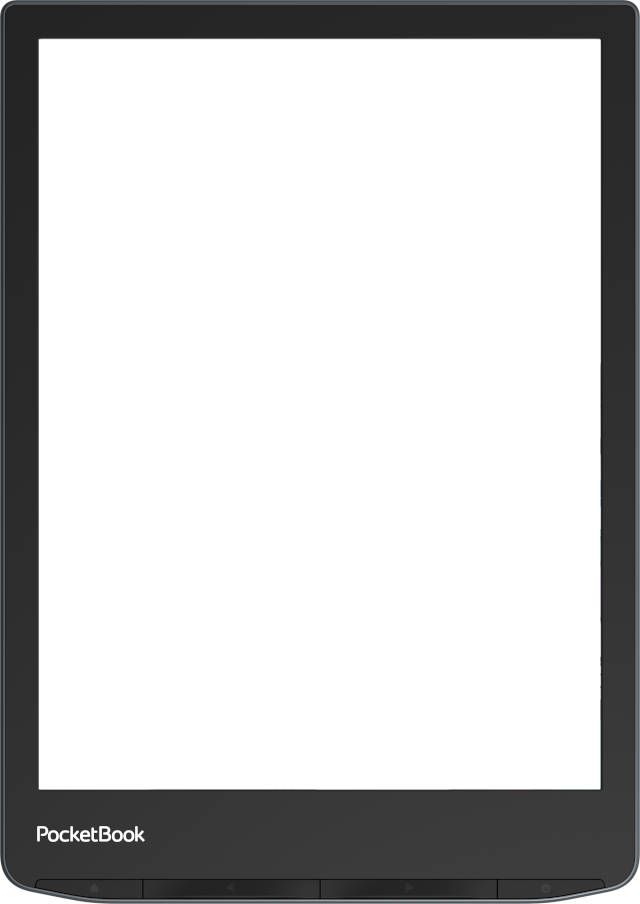
Leben mit dem Tod
Vier Essays gegen die Sprachlosigkeit | Anna-Maria Herta Klassen; Konstantin Sacher; Anna Elisabeth Scholz; Dorothea Ugi
E-Book
2022 Gütersloher Verlagshaus
192 Seiten
ISBN: 978-3-641-29294-2
in den Warenkorb
- EPUB sofort downloaden
Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Hardcover erhältlich
Für eine neue Sprache des Glaubens
Auferstehung der Toten? Unsterblichkeit der Seele? Ewiges Leben? Die traditionelle religiöse Sprache in Bezug auf den Tod sagt heute vielen nichts mehr. Muss in einer Welt, in der die Menschen, Kirchenmitglieder inbegriffen, der naturwissenschaftlichen Erkenntnis zustimmen, dass der Tod das Ende des Menschen ist, die christliche Religion angesichts des Todes verstummen?
In vier Essays zeigen die Autor*innen dieses Bandes, dass und wie die religiöse Rede vom Tod ihre Bestimmung nicht in der Vertröstung des Menschen auf ein jenseitiges Weiterleben findet und wie dennoch in den Bildwelten religiöser Sprache ein Trost liegen kann.
Ein Werk, das angesichts des Todes eine neue Perspektive findet und zeigt: Man muss den Tod anerkennen und kann dennoch zuversichtlich leben.
- Eine Theologie des Todes für das 21. Jahrhundert
- Religiöse Orientierung angesichts von Sterben, Tod und Trauer
- Ein Buch das angesichts der Endlichkeit tröstet, ermutigt und sprachfähig macht
Anna Maria Herta Klassen, Dr. theol., geb. 1986, Studium der Evangelischen Theologie in Göttingen und Halle (Saale), 2011-2015 Repetentin der Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers, 2016 Promotion an der theologischen Fakultät der Universität Göttingen, ist Pfarrerin der Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers.
Beschreibung für Leser
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
»1. Der Tod ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Er wird von ihr an den Rand gedrängt. 2. Der Tod ist ein Bestandteil unseres Lebens. 3. Es weiß ja niemand, was danach kommt. 4. Ich habe keine Angst, ich weiß ja, was danach kommt.«1 Diese Sätze habe ich in den letzten Jahren nicht selten zu hören bekommen, wenn es in einer Gesprächsrunde um das Thema Tod ging. Der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf, von dem das Zitat stammt, bezeichnet sie als »Sätze, die Sie als Vollidiot zum Thema Tod unbedingt sagen müssen«2. In seinem posthum erschienenen Buch Arbeit und Struktur hat er sich mit seinem bevorstehenden Tod auseinandergesetzt. Dabei stellt er sich auch die Frage, was ihm bei dem Gedanken an den Tod hilft und was nicht. Ohne in den schroffen Tonfall Herrndorfs einstimmen zu wollen, lohnt es sich, über diese »Sätze«, die er ablehnt, nachzudenken. Sie klingen teilweise wie kirchliche oder theologische Gemeinplätze, aber: Sind sie so selbstverständlich, wie sie scheinen?
Wird der Tod wirklich verdrängt oder hat die Auseinandersetzung mit ihm schlicht andere Formen angenommen? Kann der Tod als Bestandteil des Lebens begriffen werden oder ist er dem Leben aus der menschlichen Erfahrung heraus nicht eher radikal entgegengesetzt? Wie bringe ich die Absurdität und Grausamkeit des Todes mit dem Glauben an ein ewiges Leben zusammen? Weise ich fatalistisch darauf hin, dass ja keiner weiß, was danach kommt, und der Tod deswegen ein Geheimnis bleibt? Oder rühme ich mich, dass ich keine Angst habe, weil ich sicher bin, dass ich bei Gott sein werde?
In der folgenden Betrachtung möchte ich versuchen, aus der Perspektive des christlichen Glaubens Antworten auf diese Fragen zu formulieren und dabei die Formen des Umgangs mit dem Tod in unserer Gegenwart produktiv mit einzubeziehen.
1. Die Mehrdeutigkeit des Todes
Zuerst entfalte ich die Bedingungen, unter denen die christliche Perspektive formuliert werden kann. Diese lassen sich in der wesentlichen Einsicht zusammenfassen: Der Tod ist mehrdeutig und der christliche Glaube kann ihn ebenso wenig abschließend erfassen wie alle anderen Perspektiven. Der kurze Blick auf den gegenwärtigen gesellschaftlichen Umgang mit dem Tod (A) verstärkt diese grundsätzliche Einsicht, die sich schon aus dem Verhältnis des Einzelnen zum Tod (B) ergibt. Die christliche Rede vom Tod zeichnet sich dann dadurch aus, dass sie dieser Mehrdeutigkeit Raum lässt und auf abschließende Definitionen verzichtet (C).
A. Die Gesellschaft und der Tod: Vielfalt entdecken
Von verschiedenen Seiten wurde und wird dem Menschen und der Gesellschaft unterstellt, dass sie den Tod verdrängen: Statt sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, orientieren sie sich am diesseitigen Leben. Sie glauben sogar daran, sich durch wissenschaftlichen Fortschritt selbst unsterblich machen zu können. Auch Theolog:innen nutzen zuweilen diesen Vorwurf, um auf dessen Grundlage ihre eigenen Thesen zu entfalten. Sie nehmen die Todesverdrängung als Zeichen dafür, dass die Gegenwart 'gottvergessen' ist und 'der sündige Mensch' seine Endlichkeit nicht wahrhaben will. Der Mensch versuche den Tod zu bezwingen, indem er ihn beschönigt, verdrängt oder mit Lebensoptimierung und Unsterblichkeitsbestrebungen bekämpft.3
Alternativ dazu wird seit einiger Zeit in der Soziologie, Philosophie und Theologie folgende Annahme vertreten: Für unsere Gegenwart kann man nicht pauschal von einer Todesverdrängung sprechen.4 Eher ist davon auszugehen, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod andere Formen angenommen hat. Sie sucht sich andere als die traditionellen Räume. In den sogenannten 'gesellschaftlichen Systemen' - Wirtschaft, Wissenschaft, Recht, Politik, Religion, Erziehung, Medien, Kunst, Gesundheit5 - kommt der Tod je anders zur Sprache, je nachdem,
